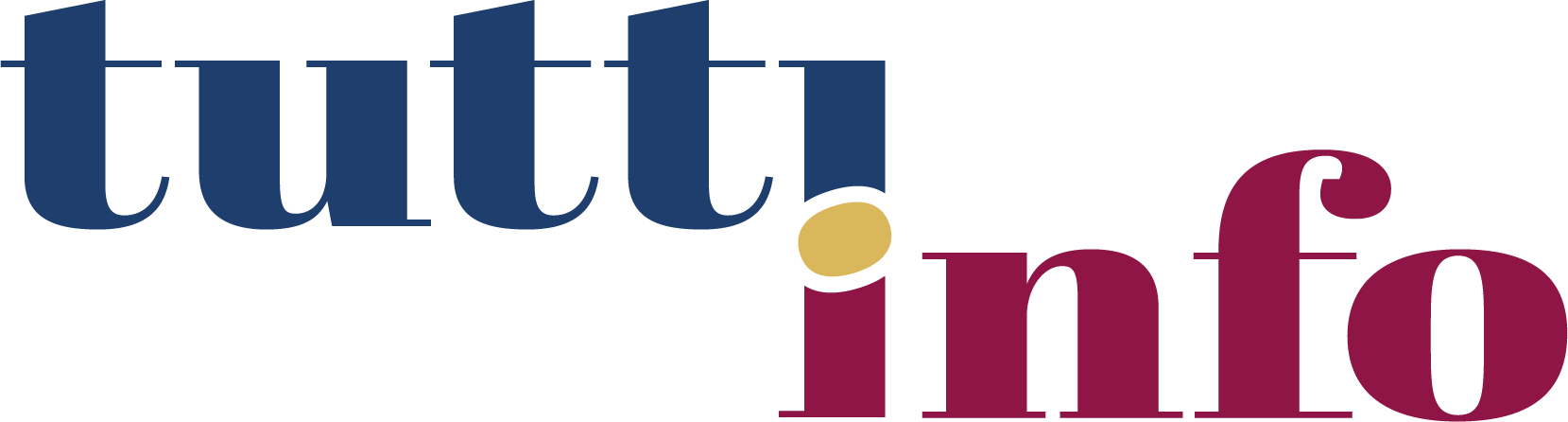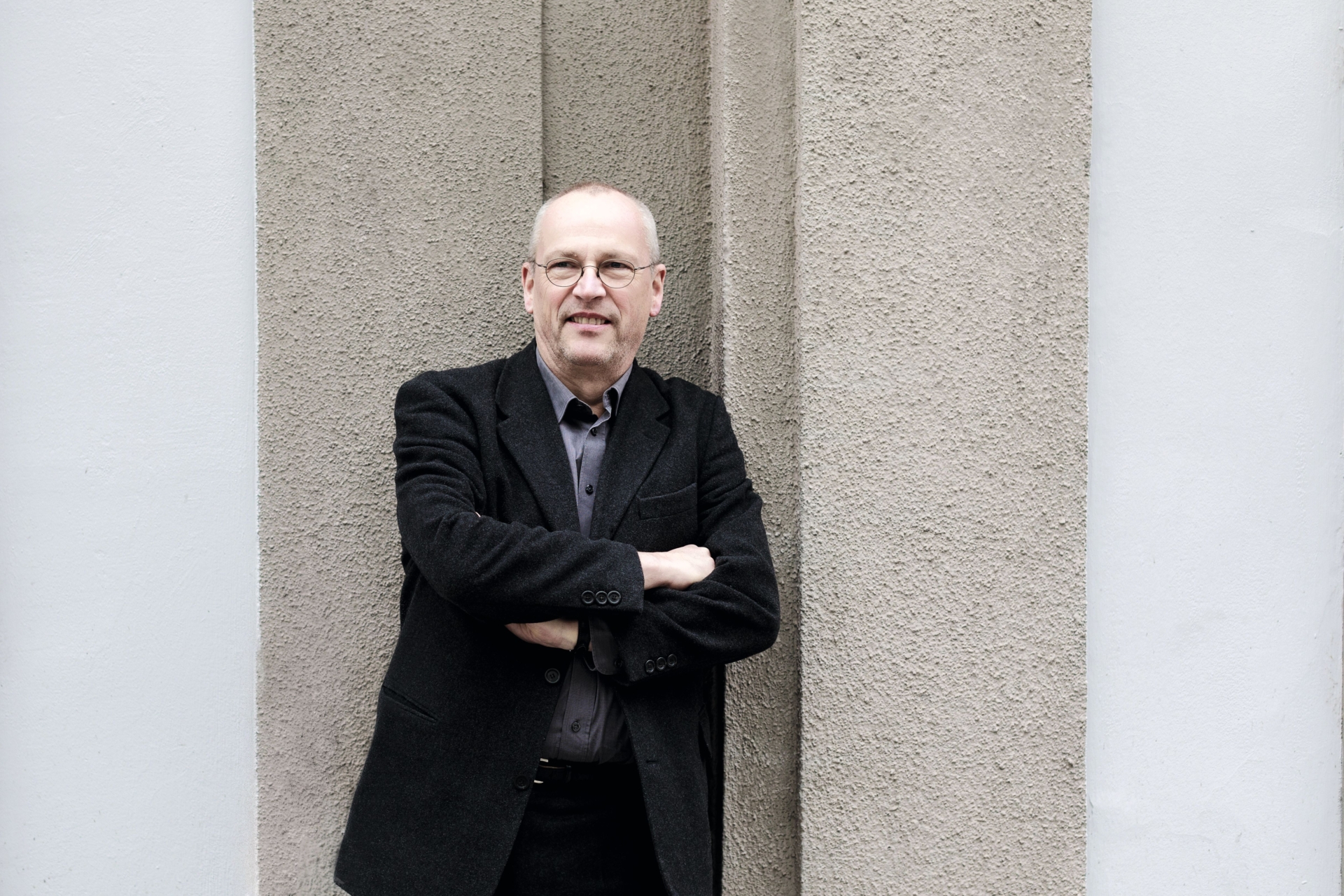Überlegungen zu Amateurorchestern von Dieter Haselbach
Es gibt eine unüberschaubare Literatur zu Musik und Gesellschaft. Mir ist als Leser aufgefallen, dass ein großer Teil dieser Literatur von Menschen erarbeitet wurde, die eine innere Beziehung zu ihrem Gegenstand haben, oder einfacher gesagt: die Musik lieben. Also ein positives Vorurteil zum Gegenstand der Untersuchung. Das ist gut so, aber es hilft nicht immer für einen nüchternen Blick, den Kulturpolitik verlangt. Verbandsarbeit wie die des BDLO braucht neben ihrem Anliegen einen solchen nüchternen Blick auf Argumente, Chancen, die eigene Bedeutung.
Musik biologisch …
Ich will einmal ganz allgemein anfangen: Die Welt ist voll von Musik, voll von Rhythmus und Klang! Mit Musik geben Lebewesen einander Signale, Musik ist ein Kanal der Kommunikation. Kommunikation dient dabei ganz unterschiedlichen Zwecken. Nehmen wir das Singen der Vögel. Es geht, soweit wir es verstehen und nicht nur genießen wollen, um das Markieren eines Territoriums, um die Suche nach Sexualpartnern, um Warnungen. Von Rabenvögeln weiß man inzwischen, dass ihre Verständigung sprachliche Elemente enthält; auch woanders gibt es Übergänge von Musik zu Sprache, die Grenze ist unklar, die beiden Kommunikationsformen gehen ineinander über. Auch bei Säugetieren ist die Grenze zwischen Musik und Sprache nicht scharf, sie verläuft bei verschiedenen Arten unterschiedlich. Zur Musik mag man auch Geräusche von Arten rechnen, die uns ferner stehen und in die wie uns schwerer hineinfühlen können. Erinnert sei bei Insekten an das Zirpen der Grillen. Inzwischen wissen wir auch, dass Pflanzen – in einem von uns nicht hörbaren Bereich – miteinander kommunizieren; unklar, ob das Musik oder Sprache ist.
Eine kurze Bemerkung zu Musik als einem Teil des Balzverhaltens, besonders bei Vögeln. Es zeigt der balzende Vogel ein Übermaß an Kraft, Fähigkeit, vielleicht Virtuosität, um die Partnerin zu überzeugen, dass er der richtige Partner ist. Es ist ein Überschuss, der hier demonstriert wird. Das Musizieren ist oft frei, es gibt zwar einen letzten Zweck, die Vereinigung mit der Partnerin, aber eben auch viel Varianz in der Gestaltung der Musik.
… und bei Menschen
Menschen in allen Kulturen haben Musik gemacht und machen Musik. Ist menschliche Musik grundsätzlich anders als die von anderen Lebewesen? Das wurde oft behauptet. Verwiesen wird dann auf die Zweckfreiheit der menschlichen Musik. Diese Zweckfreiheit oder die alleinige Ausrichtung an ästhetischen Idealen unterscheide sie von der Musik anderer Spezies. Aber ich habe eben am balzenden Vogel gezeigt, dass eine solche Zweckfreiheit in der Musikausübung auch hier möglich sein kann. Gezeigt wird der Überfluss, die Fähigkeit, über den Selbsterhalt hinaus Energie aufzubringen. Man kann argumentieren, dass auch bei musizierenden Menschen von einem Überschuss gesprochen werden kann. Und dann stellt sich sofort die Frage, ob das Zeigen eines solchen Überschusses nicht auch eine Botschaft jenseits des Musizierens enthält. Auch zweckfreies Handeln muss der individuelle Mensch wollen. Etwas wollen heißt: Zwecke verfolgen! Vor diesem Hintergrund ist es problematisch, die menschliche Musik gegenüber der Musik anderer Lebewesen mit dem Argument hervorzuheben, dass sie zweckfrei sei.
Sicher aber ist: In Rhythmus und Moderation ist die menschliche Musik höher differenziert als alles, was von anderen Lebewesen zu hören ist, zumindest soweit wir hören können. Auch die Verwendung von Instrumenten zur Musikerzeugung ist bei keiner Spezies so weit entwickelt wie beim Menschen.
Hier eine kleine Kuriosität zur menschlichen und tierischer Musikausübung. Der Dadaist Kurt Schwitters hatte sein Klanggedicht »Ursonate« (zuerst 1932) auf der norwegischen Insel Hjertøya geübt. 1997 besuchte ein mit dem Werk vertrauter Künstler die Insel, fand dort, dass Stare Teile der Ursonate in ihren Gesang aufgenommen hatten. Dies war Jahrzehnte noch durch Tonaufnahmen zu belegen; es führte sogar zu einem Urheberrechtsstreit mit dem Rechteinhaber an der »Ursonate«. Die Kuriosität lässt zumindest zweimal darüber nachdenken, ob menschliches Musizieren sich durch »Zweckfreiheit« auszeichnet: einen Zweck hatten auch die Stare nicht, als sie Schwitters Rezitationen anhörten und imitierten.
Wirkung von Musik
Ich will nun den Blick in eine andere Richtung lenken: Welche Wirkungen hat Musik, welche hat sie bei Menschen? Dass Musik wirkt, zeigt sich bei der Beobachtung von Musikhörern zweifelsfrei: Aufmerksamkeit, ein Wippen mit dem Rhythmus, ein Mitsingen oder Mitsummen, der Impuls zu tanzen. Seit dies technisch möglich ist, zeigt sich sogar das Bedürfnis, sich mit Musik gegen die Welt zu wappnen, sichtbar in der neuen Mode, mit großen Kopfhörern sich demonstrativ von der Mitwelt abzuwenden. Zu sehen auch die Freude am Wiedererkennen: fast alle Menschen haben ein musikalisches Gedächtnis. Bei Musikern ist solches Gedächtnis geübter.
Auch kann gemeinsames Musikhören ein tiefes, ein formatives Erlebnis sein. In den konventionellen Formen des Symphoniekonzerts – hier sind Menschen durch Konventionen mehr gebunden – wird das nicht so deutlich wie in der populären Musik. Menschen sind bereit, für das Miterleben eines Konzerts ihrer Stars erhebliche Gelder aufzubringen. Das ist eine klare Willensdemonstration und weist auf die Bedeutung gemeinsamen Erlebens hin. Das Radio, der Tonträger, das Streaming kann das nicht ersetzen. Das ist alles bekannt und muss nicht vertieft werden.
Wirkung des Musizierens
Dem aktiven Musizieren werden noch tiefergehende Wirkungen zugeschrieben. Immer wieder zitiert wird die These, dass durch Musizieren die kognitiven Leistungen bei Musikern, insbesondere bei musizierenden Kindern, gesteigert werden. Kann sein. Problem ist, dass solche Wirkungen nicht beweisbar sind. 2009 gab es zu diesem Thema eine Veröffentlichung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit dem sprechenden Titel »Pauken mit Trompeten« (z.B. https://tinyurl.com/5amcd2yd), in der der Forschungsstand zusammengefasst wurde. Das Ergebnis ist ernüchternd: Ja, es gibt einen Kognitionszuwachs bei Kindern. Aber er lässt sich nicht eindeutig auf das Musizieren zurückführen oder anders gesagt: Andere Faktoren können genauso wirksam und hilfreich sein.
Dasselbe lässt sich von den sozialen Kompetenzen sagen. Auch hier die verbreitete Vorstellung, dass diese gerade durch das gemeinsame Musizieren gefördert werden. Das ist sicherlich so. Aber es ist nicht klar und auch nicht zu klären, ob nicht andere Aktivitäten dasselbe Ergebnis erreichen. Vergleichende Forschung zu verschiedenen Aktivitäten gibt es praktisch nicht, es wäre auch methodisch sehr anspruchsvoll, wahrscheinlich ethisch kaum vertretbar, überhaupt in diesem Feld zu untersuchen. Das sollte vorsichtig machen, vom Musizieren zu viel solcher Wirkung zu erwarten. Wo versucht wird, mit vollmundigen Behauptungen zur Wirkung des Musizierens öffentliche Aufmerksamkeit oder gar öffentliches Geld zu erlangen, ist immer zu bedenken, dass im Zweifel auch ein Beweis zu führen wäre, der eben praktisch nicht geführt werden kann.
Noch weniger sichere empirische Evidenz gibt es zum häufig behaupteten Zusammenhang von Musizieren und Gesundheit. Das kann sein, lässt sich jedoch nicht in empirischer Forschung nachweisen. Es ist gut möglich, dass hier die Vorstellungen von musikaffinen Menschen die Darstellung solcher Zusammenhänge mehr beeinflusst haben als tatsächliche wissenschaftliche Ergebnisse. Unzweifelhaft ist, dass gemeinsames Musizieren Emotionen auslöst, die das Gefühl der Zusammengehörigkeit befestigen werden. Man denke an das gottesdienstliche Erlebnis in Kirchen, das gemeinsame Singen von Nationalhymnen, die Chöre der Fans im Fußballstadium, das Mitsingen im Popkonzert (bei der Oper ist das ja eher verpönt), natürlich auch das gemeinsame Musizieren im Orchester. Es wird immer wieder versucht, einen Anspruch auf eine Förderung durch öffentliche Gelder aus den genannten Wirkungen heraus zu begründen. Das mag kurzfristig auch einmal erfolgreich sein. Aber wo es darum geht, die behaupteten Wirkungen zu belegen, wo eine Förderung also evaluiert wird, und das ist immer häufiger der Fall bei Förderungen, sind nicht belegbare Wirkungsbehauptungen problematisch. Werden Förderentscheidungen aus erwartbaren und vom Fördergeber gewünschten Wirkung her begründet, muss auch noch der Nachweis möglich sein, dass diese Wirkungen nur durch die geförderten Aktivitäten eintreten und eben nicht auch auf anderem Wege zu erreichen sind. Würde zum Beispiel Mannschaftssport für die sozialen, Nachhilfeunterricht für die kognitiven Fähigkeiten ähnlich wirken wie das Musizieren, dann fällt ein wirkungsbezogenes Argument zur Förderung von Musik in sich zusammen.
Musizieren im Orchester, »ernste« Musik
Von der Musik in eher genereller Betrachtung nun ein paar Worte zu Orchestern im Allgemeinen, dann zu Amateurorchestern. Wesentlich für jede Orchestermusik ist der Zusammenklang. Das macht den Reiz, aber auch die Schwierigkeit des Musizierens im Orchester aus. Wer im Orchester spielt, vertraut auf die musikalische Qualität der anderen Mitglieder. Genauer: alle setzen auf die Qualität jedes anderen. Ein Missklang ist ein gemeinsamer Missklang. Deswegen erfordert das Musizieren im Orchester von den Mitgliedern hohe und verlässliche musikalische Qualität.
Historisch ist das Symphonieorchester eine Kulturleistung des neuzeitlichen Europa. Es steht, in allen seinen Formen als Träger einer Tradition europäischer, später europäischamerikanischer Musik. Inzwischen ist diese Musik weltweit verbreitet, sie erfährt auch aus anderen Musiktraditionen immer wieder Anregungen, aber im Kern, vor allem der Tonalität, bleibt sie europäisches Erbe.
Zunächst zu Profi- oder Berufsorchestern. Passend hier eine Definition des »Kulturorchesters«, ein Begriff, der für die tariflichen Vereinbarungen von 1938 bis 2019 galt: »Kulturorchester sind diejenigen Orchesterunternehmen, die regelmäßig Operndienst versehen, oder Konzerte mit ernst zu wertender Musik spielen« – so der Text des Tarifvertrags TKV. Hier wird beiläufig eine Unterscheidung getroffen oder zumindest angesprochen, die aufschlussreich, aber auch problematisch ist. Es ist die Unterscheidung »ernster« von »Unterhaltungsmusik«. Symphonische Orchestermusik ist ernste Musik. Diese Unterscheidung bildete sich erst im 19. Jahrhundert heraus. Ob sie heute noch Gültigkeit beanspruchen kann, wird von vielen Seiten bezweifelt. Heute wird eher von »Klassik« gesprochen, während das, was früher Unterhaltungsmusik war, in vielerlei Subkategorien rubriziert wird. Wichtig ist die Unterscheidung auch, weil hier unterschiedliche Publika angesprochen werden, die sich nur teilweise überschneiden. Auch verlangt »ernste« Musik vom Publikum ein anderes Verhalten als die meisten Formen von Unterhaltungsmusik; sie haben je nach Genre ihre eigenen Verhaltensmuster entwickelt.
2010 gab es in Deutschland 133 »Kulturorchester« (nach der zitierten Definition) mit fast 10.000 Planstellen. Inzwischen sind es etwas weniger. Um die Bedeutung des BDLO zu verstehen, vergleiche man dies mit den Mitgliedszahlen des BDLO: 34.000 Musizierende in 880 Orchestern. Allerdings ist naturgemäß die Zahl der Veranstaltungen zwischen Profi- und Amateurorchestern krass unterschiedlich, denn Amateure musizieren in ihrer Freizeit. Symphonische Musik verlangt auch im Amateurbereich ausgeprägte musikalische Fähigkeiten. Sonst gelingt der Zusammenklang nicht. Das Repertoire auch der Amateurorchester ist wahrscheinlich richtig beschrieben, wenn man sagt, dass der Schwerpunkt in der »Klassik« liegt.
Ökonomie des Musizierens
Viel wurde in den letzten beiden Jahrzehnten über Musik als Wirtschaftsfaktor gesprochen. Ich möchte kurz betrachten, ob diese Diskussion auch für Amateurorchester eine kulturpolitische Bedeutung hat. Kulturwirtschaft gilt allgemein als Schlüsselbranche, als innovativ, als wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ihre Größe und Entwicklung, ihre Zusammensetzung, ihre Probleme, all das wird regelmäßig durch öffentliche Forschungsaufträge ausgemessen. Blickt man allerdings tiefer in die Definitionen und Zahlen, drängen sich einige Zweifel über diese Attribute auf. »Kulturwirtschaft« ist ein problematisches statistisches Konstrukt aus vielerlei Branchen und Berufsfeldern. Nicht alle sind innovativ, nicht alle wachstumsträchtig, viele kämpfen, gerade mit der Digitalisierung und ihren Folgen. Besonders die Musikbranche hat in den letzten drei Jahrzehnten eine rasante Entwicklung und eine tiefe Krise durchlebt, weil die wachsenden digitalen Möglichkeiten alle Wertschöpfungsketten radikal verändert haben. Diese Krise gilt auch für die »Klassik«, aber mit einer zeitlichen Verzögerung, denn ihre Konsumenten sind konservativ und öffentliche Förderung federt viele der Disruptionen ab.
All dies ist für die Amateurmusik nur begrenzt wichtig. Man kann sagen, dass Amateurmusik als Wirtschaftsfaktor nur sehr begrenzt relevant ist. Zwar bietet der Sektor einigen Profis ein berufliches Tätigkeitsfeld, sei es in der Musikpädagogik, sei es dirigierend oder als Coach, sei es als Verstärkung in manchen Aufführungen von Amateurorchestern. Auch werden Sachmittel gebraucht, das reicht von der Kleidung, die manche Orchester vereinheitlichen möchten, bis hin zur Notenliteratur. Hier allerdings liegt ein wichtiges und kostenentlastendes Tätigkeitsfeld des BDLO. Aber alles das ist, gemessen an den ökonomischen Kennzahlen des Musikmarktes, von nur untergeordneter Bedeutung. Einzig beim Kauf und Erhalt der Musikinstrumente spielt das Amateurschaffen eine quantitativ bedeutende Rolle.
Ein anderer ökonomischer Zusammenhang ist für die Orchestermusik interessanter. In den 1960er Jahren formulierte der US-Wirtschaftswissenschaftler William J. Baumol eine Formel, die als »Baumol’sches Gesetz«, auch als die die »Baumol’sche Kostenkrankheit (cost disease)« in der kulturwissenschaftlichen Diskussion wichtig ist. In aller Kürze geht es darum, dass persönliche Dienstleistungen, in denen das menschliche Handeln vor Ort notwendig ist, gegenüber Industriewaren tendenziell relativ immer teurer werden. Bei Industriewaren führen Produktivitätssteigerungen, Rationalisierungsvorteile (Umweltkosten, die sogenannten Externalitäten waren noch kein Thema) und Vorteile der Massenproduktion zu ständigem Kostensenkungsdruck. Das ist bei persönlichen Dienstleistungen nicht so. Man denke an die Friseurtätigkeit: Hier muss vor Ort ein konkreter Kopf behandelt werden, das braucht seine Zeit. Man denke an die Kellnerarbeit: Das würde sich erst ändern, wenn es Bedienungsroboter geben sollte – aber möchte man dann noch essen gehen?
Besonders deutlich wirkt sich die Kostenkrankheit in den darstellenden Künsten (Theater, Tanz) aus, noch signifikanter in der Orchestermusik mit der notwendigen Mindestbesetzung, ganz krass in der Oper, die Orchester und Bühnenpräsenz erfordern, plus dem technischen Apparat, der von Menschen vor Ort und aktuell bedient wird, im Hintergrund. Kostenersparnisstrategien aus der Industrieproduktion sind nicht anwendbar. Wagners Musik verlöre viel von ihrem Charakter, würde sie von einem Kammerorchester aufgeführt.
Für öffentliche Theater und Berufsorchester wird der Effekt der Kostenkrankheit durch stetig steigende Förderung abgefangen, solange die öffentlichen Kassen und der kulturpolitische Wille das hergeben. Durch den Ticketpreis lassen sich Kostensteigerungen längst nicht mehr auffangen: ein Konzert- oder Opernbesuch würde deutlich dreistellig kosten müssen, für jedes Ticket. Berufsorchester kommen bei jeder Krise öffentlicher Finanzen tendenziell in Schwierigkeiten. Das wird sich gerade in den kommenden Jahren und Jahrzehnten zeigen, wo bisher nicht dominante öffentliche Aufgaben wie Klima und Infrastrukturanpassungen immer wichtiger werden. Die Amateurorchester sind dem Baumol’schen Gesetz teilweise entzogen, denn es wird nicht entlohnt oder honoriert. Amateurorchester werden in dieser Entwicklung, um die Praxis und die Tradition der Orchestermusik zu erhalten, an Bedeutung gewinnen.
Ein letztes ökonomisches Thema sei nur kurz angesprochen: Geförderte Kultureinrichtungen verwandten in den letzten Jahren viel Energie in das Argument, dass geförderte Kultur über eine »Umwegrentabilität« mehr Geld in öffentliche Kassen bringen würde, als die ursprüngliche Förderung kostet. Das soll funktionieren, weil Kulturbesuche Zusatzkonsum auslösen, weil die Spielorte Bekanntheitsvorteile bekommen, weil durch sie Tourismus gelenkt wird. Ich habe viele solche Rechnungen gesehen, keine geht auf. Konzeptionell schwierig ist zum Beispiel, auf Kulturtourismus zu setzen: Wer sein Geld bei einem Konzert in Dresden ausgibt und dazu ein Hotel und Fahrten in Anspruch nimmt, wird hinterher feststellen, dass er dieses Geld in Dinslaken eben nicht mehr ausgegeben kann. Also sind die Umwegrentabilitäten bestenfalls Verschiebungen von Ausgabeströmen, bewirken aber, aufs Ganze gesehen, keine zusätzliche Rentabilität. Das Geld fehlt in der einen Tasche, ist aber vielleicht in anderen.
»Musik, Musizieren, Musik hören, Musiktraditionen pflegen hat einen eigenen Wert.«
Warum all diese ökonomischen Darstellungen? Für die Verbandspolitik der Amateurorchester sind die verhaltensökonomischen und wirtschaftlichen Argumente nicht brauchbar. Es gibt bessere Begründungen für das eigene Tun. Zu suchen sind solche Begründungen darin, dass Musik, Musizieren, Musik hören, Musiktraditionen pflegen, einen eigenen Wert hat.
Es bleiben ökonomische Probleme und Engpässe, die alle Orchesterarbeit betreffen und für die auch im Amateurbereich Hilfe der öffentlichen Hand gesucht werden kann. Jedes Orchester kann nur das Repertoire spielen, das seine Besetzung zulässt. Berufsorchester können Aushilfen holen, solange das Budget reicht. In der Laienmusik ist das schwierig. Es kann nicht in andere Taschen gegriffen werden. Ein Orchester braucht Probenräume. Die Förderung von Berufsorchestern richtet sich auch auf die entsprechende Infrastruktur. Für Amateurorchester ist das schwieriger und auch hier müssen Kosten getragen werden. Ebenso braucht es Aufführungsräume. Ein Orchester ist um so teurer, je größer es ist. Für Berufsorchester ist das evident. Aber es gilt auch für Amateurorchester. Probenräume, Aufführungsräume werden teurer. Größe ist ein Multiplikator bei gemeinsamer Kleidung, bei den Notensätzen, in der Kommunikation, in der Mitgliederverwaltung.
Was bedeutet dies für das Aufgabenprogramm der Amateurorchester vor Ort und für den Verband? Der Verband kann und soll Aufgaben wahrnehmen, die Sichtbarkeit und Akzeptanz der Arbeit von Amateurorchestern zu erhöhen. Er kann Wege bahnen, um ökonomische Probleme, die die meisten Ensembles betreffen, bearbeitbar zu machen. Das gilt auch und gerade für die Landesverbände: Es gibt einige kulturpolitische Themen, die den Bund betreffen, hier muss der Bundesverband tätig werden. Aber die Kulturhoheit liegt bei den Ländern, ebenso wie der überwiegende Teil möglicher Fördergelder hier und bei den Kommunen verteilt werden. Für das einzelne Orchester ist die kulturpolitische Aufgabe vor allem anderen, eine gute Position vor Ort, in der eigenen Kommune, zu erarbeiten.
Dieter Haselbach studierte Soziologie in Marburg, wo er 1984 promoviert und 1991 habilitiert wurde. Er war in Darmstadt, Graz und Marburg als Hochschuldozent tätig, zwischen 1992 und 1995 DAAD Associate Professor in Victoria (British Columbia) und von 1996 bis 2000 Reader and Head of Politics and Modern History an der Aston University in Birmingham. Seit 1999 ist er als Unternehmensberater mit einer Spezialisierung auf öffentliche Kulturbetriebe tätig. Er ist Direktor des Zentrums für Kulturforschung. 2012 veröffentlichte er zusammen mit drei weiteren Autoren »Der Kulturinfarkt: Von Allem zu viel und überall das Gleiche. Eine Polemik über Kulturpolitik, Kulturstaat, Kultursubvention.«