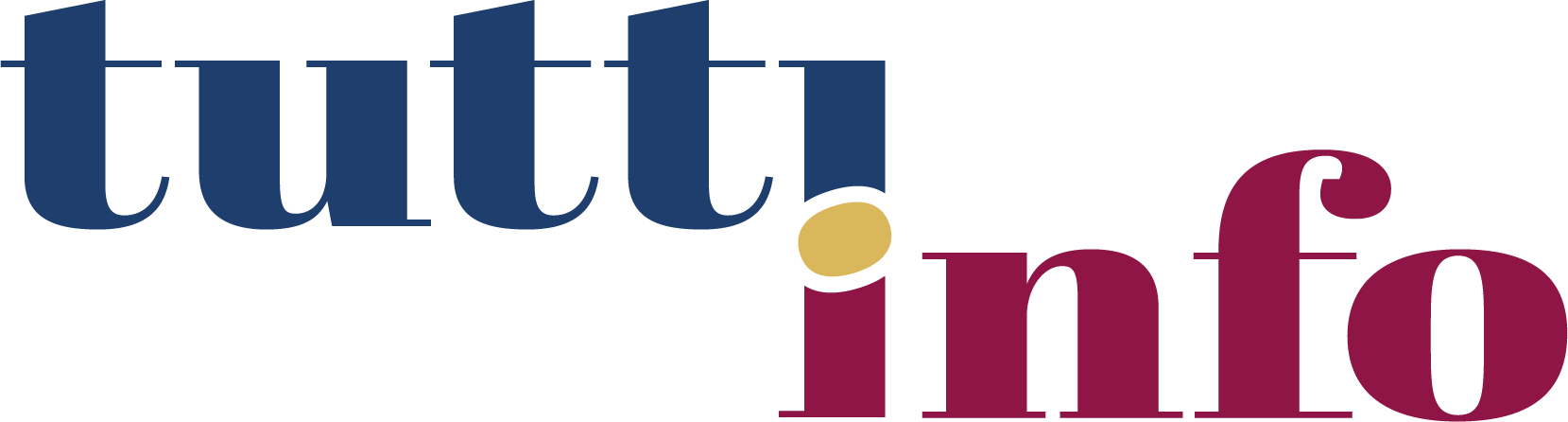Ein Orchester findet sich zusammen
Von allen Meilensteinen eines sich neu zusammenfindenden Orchesters auf dem Weg zum abschließenden Konzert ist der Moment der ersten Anspielprobe stets einer der am meisten ersehnten. Hier entsteht zum ersten Mal eine Ahnung davon, was aus diesen Noten, aus diesen Instrumenten, aus diesen Musikerinnen und Musikern heraustreten kann, welche Gefühle und Empfindungen geformt und weitergegeben werden.
Doch geht auch diesem Erlebnis bereits sehr viel voraus: Von dem riesigen Organisationspensum eines solchen Projektes lässt sich als Musikerin oder Musiker nur jener Bruchteil erahnen, der in Form von Noten, Probenplänen, Unterkünften und vielen weiteren kleinen und großen Programmpunkten erlebbar wird. Die Umsetzung dieser Pläne begann für die Teilnehmenden des Orchesters am 02.10.2024. Bei der Anreise zur Bildungsstätte Koppelsberg in Plön zwischen Kiel und Lübeck sammelten sich bereits jene Teile des Orchesters, die sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln durch Instrumentenkoffer, Gepäck für eine mehrtägige Reise und durch gleiches Umsteigeverhalten an den dem Probenort näherkommenden Bahnhöfen gegenseitig entdeckten. Spätestens wurde die Phase des Kennenlernens dann aber beim Beziehen der Zimmer begonnen und beim gemeinsamen Abendessen intensiviert.
Die Ergebnisse der persönlichen Vorbereitung auf das musikalische Programm sind dabei ebenso vielseitig wie die Musikerinnen und Musiker selbst. Manche sind zu Kennern aller vorhandenen Aufnahmen der Werke geworden und fachsimpeln bereits darüber, auf welche Weise diese oder jene Stelle wohl von der Dirigentin Judith Kubitz interpretiert werden würde. Andere sind bei einem augenzwinkernden Wettbieten um die Instrumentenstimme mit der technisch schwierigsten Passage anzutreffen, wogegen eine weitere Gruppe sich in den Bruchstücken ihres Wissens um die Entstehungsgeschichten der Werke zu ergänzen sucht. Allen gemein ist dabei eine große Vorfreude, die Menschen, die Musik und einen für die meisten einmaligen Konzertsaal so gut wie möglich kennenzulernen. Eine Besonderheit des Bundesamateurorchesters bestand auch dieses Jahr erneut in dem Umstand, einer Delegation von zehn Musikerinnen und Musikern aus japanischen Amateurorchestern zu ermöglichen, im Sinne eines Austausches Teil dieses Projektes zu werden.
Die Probenphase
Auf dem Programm stehen zwei Werke: das aus dem Kompositionswettbewerb „BDLO100“ hervorgegangene Preisträgerwerk „Capriccio ad iubilaeum“ von Florian Poser sowie Dora Pejačević‘ Sinfonie in fis-Moll op. 41. Als es am Abend des Anreisetages zum erwähnten Moment des ersten gemeinsamen Klanges und Anspielens kam, wurde insbesondere die Achtung vor den Werken verstärkt, denn die vorgesehenen drei Probentage würden für die Erarbeitung dieser Werke zu einer großen Herausforderung werden. Der Motivation vor Ort war jedoch ausgesprochen zuträglich, dass das Wetter den herbstlichen Tagen am idyllisch gelegenen Plöner See eine durch die zahlreichen Kastanienbäume vollendete Vergoldung bescherte. Dadurch konnten die Pausen draußen verbracht und der Kraftverlust durch die ein oder andere fordernde Registerprobe ausgeglichen werden.
Ein wichtiger Schritt für das Verständnis von Pejačević‘ Sinfonie war eine am zweiten Probentag stattfindende Filmvorführung des Dokumentarfilms „DORA – Flucht in die Musik“ der preisgekrönten Filmschaffenden Kyra Steckeweh und Tim van Beveren. Die Möglichkeit, der Komponistin auf historische, musikalische und persönliche Weisen näher zu kommen und dadurch ein besseres Gefühl ihrer musikalischen Ideen zu erlangen, bildete eine wertvolle und lang nachhallende Erfahrung. Komplettiert wurde dieser Abend durch ein unerwartet ermöglichtes Gespräch als Videoanruf mit dem Regisseur Tim van Beveren, der durch seinen Film nicht nur zur Wiederentdeckung Pejačević‘, sondern auch zur Findung des Programms einen wesentlichen Beitrag geleistet haben dürfte.
Die Erarbeitung von Posers „Capriccio ad iubilaeum“ wurde von seinem unerwarteten Tod wenige Monate zuvor, am 19.07.2024, überschattet. Es ergab sich daraus der Anspruch, seine Ideen und Interpretationen, auch mit Hilfe eines ehemaligen Schülers von ihm, so gut es geht zu rekonstruieren, um die Uraufführung zu einer besonderen Würdigung des Perkussionisten und Vibraphonisten werden zu lassen. Vorangegangen war die Entscheidung der Jury des Kompositionswettbewerbes „BDLO100“, die sein Werk aus einer Vielzahl von Einsendungen für den Anlass des Jubiläumskonzertes als am besten geeignet heraushob und auszeichnete.
Während der Probenphase in Plön wechselten sich Register- und Gesamtproben ab, um den technischen und klanglichen Fortschritt gleichermaßen zu ermöglichen. Spätestens jetzt wurde das Bewusstsein für große musikalische Bögen, Wechselspiele zwischen und innerhalb der Register sowie individuelle Rollen zur Herbeiführung bestimmter Gefühle und Empfindungen erzeugt. Insbesondere die Sinfonie zeigte sich dabei durch ihre Bandbreite des musikalischen und emotionalen Spektrums als herausragend und ließ dadurch jedwede Formen abwechslungsarmer Probenerlebnisse vermissen. Das „Capriccio ad iubilaeum“ hingegen war im Vergleich das weniger komplexe und demzufolge in gewisser Weise ein erleichterndes und die Rückbesinnung auf die Spielfreude zu sich groß aufbauenden und umwallenden Klängen ermöglichendes Werk.
Die Elbphilharmonie
Das Konzert rückte dann ein ganzes Stück näher, als die Bildungsstätte Plön am Mittag des 04.10.2024 verlassen wurde, um die weiteren Proben in die Räumlichkeiten der Elbphilharmonie zu verlegen. Erst einmal war es jedoch noch nicht möglich, den des für seine „Weinberg-Architektur“ und die akustischen Reflexionen optimierenden Konzeptes bekannt gewordenen großen Saales zu erleben. Stattdessen wurde in einem bedeutend engeren Probenraum die musikalische Verfeinerung fortgeführt. Dennoch war dieser erste Blick hinter die Kulissen eines so großen Konzerthauses auch schon beeindruckend genug, um sich die Erfahrung des großen Saales guten Gewissens auch für den nächsten finalen Tag aufsparen zu können.
Dieser begann mit einer nach Bläsern und Streichern gestaffelten Einheit Musizierendengesundheit durch den am Institut für Musikermedizin an der Hochschule für Musik Dresden tätigen Ralf-Ulrich Mayer. Das Bestreben der Organisatoren war es, das Orchesterprojekt auch dafür zu nutzen, die Bildung über Arten und Prävention von Musikerkrankheiten zu erweitern. Zu diesem Zweck gab es nicht nur die aktiven Übungen, sondern bereits in Plön einen Vortrag von Christine Sickert, die nicht nur als Hornistin ein Teil des Orchesters war, sondern auch an der Musikhochschule Lübeck Forschungsprojekte, insbesondere zum Thema Auftrittsangst, betreut und eine allgemeine Einführung in die Problematik gab. Denn durch umfangreiche Studien zeigt sich, dass Musikerkrankheiten sowohl physischer als auch psychischer Natur nicht nur eine stark unterschätzte Problematik unter professionellen Musikerinnen und Musikern bilden, sondern auch in der Breite der Amateurmusik erhebliche Belastungen und langfristige Schäden hervorrufen.
Nachdem diese Gefahren ein Stück weit reduziert wurden, stand die erste Probe im großen Saal der Elbphilharmonie auf dem Plan. Schnell wurde der architektonische Eindruck durch den akustischen in den Schatten gestellt. In diesem Raum verschließt sich jede Ausrede, andere Instrumentengruppen nicht haben hören zu können. Der Klang sortiert sich in einer Weise, die als ein Optimum räumlich aufgelöster akustischer Transparenz verstanden werden darf. Die Erhaltung selbst der leisesten Klänge bedeutet nicht nur für das Orchester einen Anspruch, der sich die absolute Sicherheit im musikalischen Zusammenspiel als Ideal setzt, sondern auch die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einer Verantwortung über das Konzerterlebnis aller belegt.
Das Gelingen eines Konzerterlebnisses wird logischerweise nur zu einem gewissen Grade durch die Musik bestimmt, auch wenn dies sicherlich den Hauptteil darstellt. Essentiell ist auch der Saalaufbau und die damit verbundene Logistik. Erschwerend kam in diesem Bereich der Vorbereitung hinzu, dass das Festkonzert Darbietungen zweier Orchester enthielt: das Bundesamateurorchester übernahm den zweiten Konzertteil, während ein Projektorchester, bestehend aus Mitgliedern des Landesjugendorchesters Hamburg und des Norsk Ungdomssymfoniorkester, den ersten Teil ausfüllte. Dieser bestand aus Auszügen der Suiten Nr. 1 und Nr. 2 aus „Romeo und Julia“ op. 64a/b von Sergej Prokofjew, György Ligetis „Lontano“, sowie „Pini di Roma“ von Ottorino Respighi.
Die wechselnden Besetzungen innerhalb der Stücke, aber auch zwischen den Orchestern bedeuteten das Erfordernis exakter Pläne des Standortes jedes Stuhles, jedes Notenpultes und weiterer zahlreicher kleiner Besonderheiten, um die Anpassung des Aufbaus so effizient wie möglich werden zu lassen. Unterstützung dafür bestand in der Person des langjährigen Orchesterwartes des NDR-Sinfonieorchesters und damit mit dem Haus bestens vertrauten Ernst-Ulrich Kammradt. Zudem sollte auch an dieser Stelle der hohe Anspruch der Architekten zu erleben sein, wenn es um die Minimierung der Wege zwischen Lastenaufzug und Bühne und die Optimierung der Raumaufteilung in diesem Zwischenbereich ging.
Das Jubiläumskonzert
Schließlich war es endlich so weit: Die letzte Probe schloss den weit vorangeschrittenen, wenn auch noch nicht bis zu den höchsten Ansprüchen angelangten Erarbeitungsprozess schweren Herzens ab und die mit der Saaltechnik Vertrauten feilten an den Umbauplänen. Der darauffolgende Nachmittag stand weitestgehend zur freien Verfügung und wurde meist für das Genießen der in Hamburg selten anzutreffenden herbstlichen Wärme genutzt. Das Konzert begann um 19.30 Uhr, was sich angesichts des umfangreichen Programms als später Auftakt eines langen, aber auch als die Vielfalt und Wichtigkeit der Motivation zu diesem Festakt unterstreichenden Konzertes erweisen sollte. Unterbrochen wurde die musikalische Klangfülle u.a. durch Grußworte von Helge Lorenz, Präsident des BDLO, Henrik Aarnes, Vorsitzender des De Unges Orkesterforbund, durch eine Geschenkübergabe des Japanischen Amateurorchesterverbandes (JAO) und durch eine Schweigeminute zu Ehren Florian Posers, dessen Werk in direktem Anschluss als Uraufführung gewürdigt werden konnte.
Der von der Brillanz der Jugendorchester begonnene Bogen des Festkonzertes wurde somit durch das Bundesamateurorchester vollendet. Die letzten Klänge des Abends oblagen Dora Pejačević‘ Sinfonie, deren Aussagekraft und Tiefe die letzten Zweifel an der Bedeutung der Amateurorchester, wie auch an ihrem eigenen Oeuvre rückstandslos verwischte. Nach mehr als drei Stunden ging das Festkonzert zu Ende und Musizierende wie Zuhörende verließen, an lange nachklingenden Erfahrungen reicher, die Elbphilharmonie.
Das Bundesamateurorchester 2024 ist zu einem Höhepunkt des Festjahres geworden. Möglich geworden ist dies durch das leidenschaftliche Engagement zahlreicher Menschen im Hintergrund. Die wesentlichen Fäden hielt dafür die Projektmanagerin Sabrina Lindemann in der Hand, die nicht nur akribisch jeden Planungsschritt vorbereitete und zur Verwirklichung begleitete, sondern auch ein sich punktuell schnell veränderndes Team zur Assistenz der unzähligen Arbeitsschritte souverän anleitete. Für Musikerinnen und Musiker ist die Möglichkeit, in einem so bedeutsamen und akustisch vollendeten Konzertsaal wie der Elbphilharmonie aufzutreten, ein großes Privileg und eine noch größere Freude, die dem mittlerweile vergangenen Jubiläumsjahr eine beständige Lebendigkeit in der Erinnerung beschert.